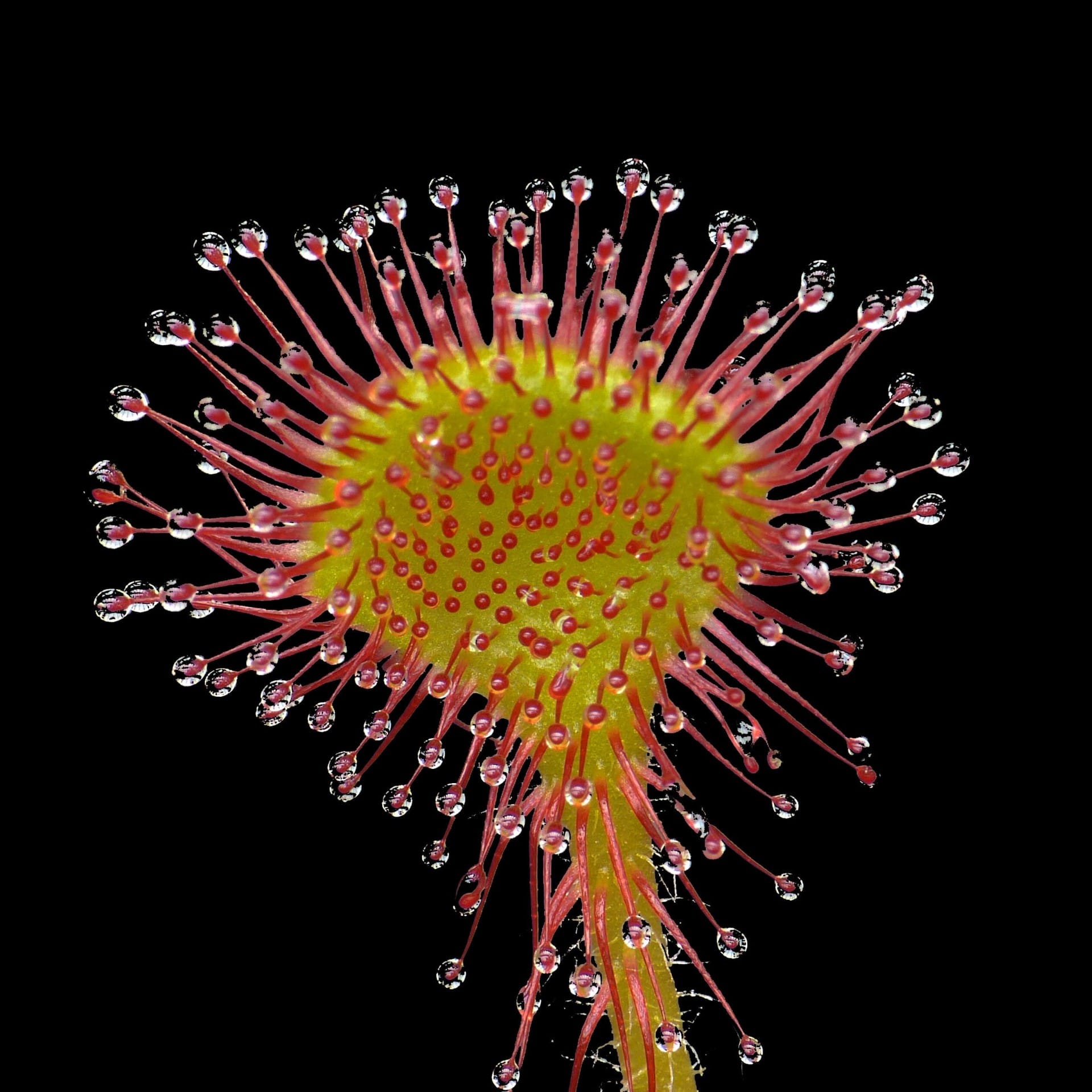Aktuelles
Heimische Natur verstehen, bewahren und erklären ...



... bei der Pollichia nicht nur ein Motto, sondern Leitgedanke bei allen Aktivitäten. Im Jahr 1840 gegründet, erfreut sich die Umweltorganisation tatkräftiger Unterstützung der rund 2.400 Mitglieder. Arbeitskreise, lokale Gruppen, Freiwillige und Fördernde arbeiten Hand in Hand, wenn es um Naturforschung, Naturschutz und Umweltbildung geht.
Veranstaltungen
Die 5 kommenden Termine oder Veranstaltungen werden angezeigt.
Alle Veranstaltungen
Unsere drei Säulen
Mitmachen und unterstützen
Es gibt vielfältige Möglichkeiten in den regionalen Gruppen, den Arbeitskreisen oder Projekten mitzuwirken.
Natürlich helfen uns auch Ihre Mitgliedschaft oder finanzielle Zuwendungen zum Beispiel zur Förderung der langfristigen Pflege unserer Naturschutzflächen oder anderer Projekte. Unsere Pollichia-Stiftung bietet mittels Zustiftungen die Möglichkeiten für ein ewiges Vermächtnis.